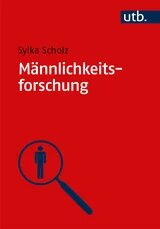Die Soziologin Sylka Scholz liefert eine umfassende Bestandsaufnahme der Männlichkeitsforschung. Einen Schwerpunkt ihres neuen Buches bilden die Verbindungslinien zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.

Entgegen der Wahrnehmung ihrer Gegner sind die Gender Studies hierzulande immer noch randständig. In parlamentarischen Anfragen der AfD taucht regelmäßig die Behauptung auf, weit über hundert Professor*innen würden sich an deutschen Hochschulen mit Geschlechterforschung beschäftigen. Dabei sitzen die wenigsten dieser Wissenschaftler*innen auf einem eigenen Lehrstuhl. In ihrem beruflichen Alltag sind Genderthemen oft nur schmückendes Beiwerk an anderen Fakultäten, in Studienfächern wie Psychologie, Soziale Arbeit oder gar Literatur.
Immerhin konnte sich die Frauen- und Geschlechterforschung im Fahrwasser der feministischen Bewegungen in den vergangenen Jahrzehnten auf niedrigem Niveau institutionalisieren. Noch prekärer aufgestellt aber ist die akademische Arbeit über Männlichkeiten. Sylka Scholz von der Universität Jena ist eine der wenigen Wissenschaftler*innen, die sich auf diesem Feld profiliert haben. Wie die meisten ihrer Kolleg*innen kann sie oft nur “nebenbei” Veranstaltungen zu Genderfragen anbieten. Die Soziologin hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass ihre Seminare und Vorlesungen zu Themen wie Rollenstereotype oder sexuelle Orientierung auf großes Interesse stoßen und häufig überfüllt sind.
Daher hat Scholz jetzt ein Grundlagenwerk zur Männlichkeitsforschung vorgelegt. Als Lehrbuch konzipiert richtet es sich vorrangig an Studierende, bietet aber auch anregendes Material zur Geschichte eines unterbelichteten Fachgebiets. Analysiert werden zunächst Schlüsselbegriffe wie hegemoniale Männlichkeit, männlicher Habitus und männliche Sozialisation. Scholz liefert einen Überblick über die wichtigsten Bereiche der Konstruktion von Männlichkeiten wie Erwerbsarbeit, Vaterschaft, Paarbeziehung, Migration und Rechtspopulismus. Auch neuere alternative Ansätze wie Queer- und Transtheorien hat die Autorin eingearbeitet.
Transfeindliche Ressentiments
International wegweisend für die Männerforschung war vor allem die Australierin Raewyn Connell. Als Transperson passte die renommierte Wissenschaftlerin perfekt in die dekonstruktive Gender-Debatte. Sie löste mit ihrer Transition aber auch eine Welle polemischer Reaktionen durch antifeministische Blogger aus. Diese stellten in Frage, ob eine Transperson überhaupt qualifiziert über Männlichkeit schreiben könne. Die Antwort lautet: Ja, sie kann. Connell hat den vielzitierten Begriff der “patriarchalen Dividende” geprägt. Danach profitieren alle Männer, auch die weniger erfolgreichen, von der ihnen zugeschriebenen Rolle, auf ihren Vorteilen qua Geschlecht - ohne sich dessen stets bewusst zu sein: Den “Kontrast zwischen kollektiver Privilegiertheit und persönlicher Unsicherheit” benennt die inzwischen emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Sydney als “Schlüsselsituation der gegenwärtigen Männlichkeitspolitik”.
Raewyn Connell war 1999 für ein Jahr an der Ruhr-Universität Bochum tätig. Eingeladen hatte sie Ilse Lenz, dort Lehrstuhlinhaberin für Soziologie, profunde Kennerin der Geschichte der Frauenbewegungen und eine der Pionierinnen der Gender Studies in Deutschland. Die damals schon weltweit bekannte Autorin übernahm die an eine österreichische Sozialforscherin erinnernde Marie-Jahoda-Professur, als prominente Gast- und Vortragsrednerin wurde sie in Seminaren, Vortragsveranstaltungen und akademischen Zirkeln herumgereicht. Im Gegensatz zur postfeministischen Ikone und Adorno-Schülerin Judith Butler schrieb Raewyn Connell stets klar und verständlich. Sie erläuterte das grundlegende Konzept der “hegemonialen Männlichkeit” immer wieder mit Fallbeispielen und stellte politische Bezüge her. Das war ein Grund für den Erfolg ihres wichtigsten Buches, das unter dem Titel “Der gemachte Mann” Ende der 1990er Jahre auch auf Deutsch erschien.
Zur umfangreichen Rezeption Connells über Fachkreise hinaus trug das im Untertitel enthaltene Wort “Krise” bei. Dass Männer am Ende, ein Auslaufmodell oder gar das “betrogene Geschlecht” seien, war um die Jahrtausendwende ein häufig verwendetes Label in wissenschaftlichen Texten, populären Sachbüchern und auch im politischen Feuilleton. Sylka Scholz steht der verkürzten Diagnose “Männer in der Krise” skeptisch gegenüber. Deren “dramatisierende Verwendung” erfolge in den öffentlichen Diskursen “meist unreflektiert”, kritisiert die Soziologin. In der deutschen Geschichte, erinnert sie, galten “bereits die Zeit um 1900, die Zeit nach dem Ersten und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als Männlichkeitskrise”.
Gravierende Forschungslücken
Die Krisen-Formel nutzen seit einigen Jahren verstärkt rechtspopulistische Kreise, denen die weibliche Emanzipation zu weit geht und die stattdessen eine Rückkehr zu traditionellen Rollenbildern propagieren. Die AfD und ihr Umfeld instrumentalisieren den Modebegriff für ihre Ideologie, analysiert Scholz: “Behauptet wird eine Krise der Männlichkeit, versprochen wird eine Resouveränisierung von männlicher Herrschaft.” Das im rechten Denken zentrale Konstrukt der Volksgemeinschaft fußt auf dem biologisch begründeten Modell der Zweigeschlechtlichkeit, entsprechend werden Männer und Frauen unterschiedliche Aufgaben zugeschrieben. Weiblichkeit verknüpfen Rechtsextreme mit Mutterschaft, Männlichkeit mit dem familiären Ernährer. Parallel, so Scholz, werde “der rechte Mann als Kämpfer” propagiert: “Während soldatische Männlichkeit in der bundesdeutschen Nachkriegszeit marginalisiert wurde und die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft bis heute umstritten ist, gilt sie der extremen Rechten als positives Gegenmodell.”
In der Forschung über die Zusammenhänge von hegemonialer Männlichkeit und Rechtsextremismus klaffen gravierende Lücken. Klaus Theweleit hatte dazu schon Ende der 1970er Jahre mit den “Männerphantasien” einen wichtigen Beitrag geleistet. Eine der wenigen neueren Arbeiten legte 2010 Andreas Heilmann vor. Sie beschäftigt sich mit der damals noch wichtigen NPD, die mittlerweile aber fast bedeutungslos ist. Detaillierte genderspezifische Analysen zum Umfeld der AfD, die den Antifeminismus als Brückenideologie nutzt und eine “maskulinistische Identitätspolitik” propagiert, fehlen bislang weitgehend. Hinweise darauf finden sich am ehesten in den Leipziger Autoritarismus-Studien und in einer österreichischen Untersuchung von Birgit Sauer und Otto Penz über die “Affektiven Strategien der autoritären Rechten”.
Konstruktion “Brauner Ostmann”
Ein besonderes Anliegen ist der 1964 geborenen und in der DDR aufgewachsenen Sylka Scholz die Berücksichtigung einer ostdeutschen Perspektive. So sei die rege Debatte um die “neuen Väter” nach der Jahrtausendwende einseitig westdeutsch geprägt gewesen. Denn im realen Sozialismus hätten sich die Geschlechterverhältnisse durch die selbstverständliche Berufstätigkeit von Frauen weit früher angeglichen - auch wenn von “Caring Masculinities”, also einer egalitären Verteilung der Haus- und Erziehungsarbeit, auch dort keine Rede sein konnte.
Ebenso kritisch sieht die Soziologin die heutige “diskursive Konstruktion des braunen Ostmannes”. Diesen ausschließlich als Verlierer der Transformation, als “frustriert, abgehängt und wütend” darzustellen, sei unangemessen - trotz der skandalösen Vorfälle in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda nach der Wende, die als “Baseballschlägerjahre” in die Geschichte und in die wissenschaftliche Debatte eingingen. Auch die weit überdurchschnittlichen Stimmenanteile von Männern für die AfD bei Wahlen in den neuen Bundesländern seien ein zu simples Erklärungsmuster für rechte Männlichkeiten - und keineswegs die maßgebliche Ursache für die wachsende Bedeutung des Antifeminismus in der Neuen Rechten.
Im Gegensatz zu ihrem renommiertesten Kollegen in der Männerforschung Michael Meuser, der sich stets als empirischer Wissenschaftler und nie als politischer Aktivist verstanden hat, bekennt sich Scholz ganz in der Tradition Connells durchaus zu praxisbezogenen Implikationen. Sie will über den universitären Kontext hinauswirken, am Schluss ihres Buches plädiert sie daher für eine Kooperation der akademischen Geschlechterforschung mit “Jungen- und Männlichkeitspolitiken”. Als geeigneten Partner betrachtet sie vor allem das 2010 gegründete und schon kurz darauf vom Familienministerium geförderte “Bundesforum Männer”. Der genderdialogisch orientierte Interessenverband von rund 40 männerpolitischen Vereinen und Initiativen hat sich als Pendant zum Deutschen Frauenrat etabliert - und distanziert sich in seiner Plattform klar von antifeministischen Strömungen.